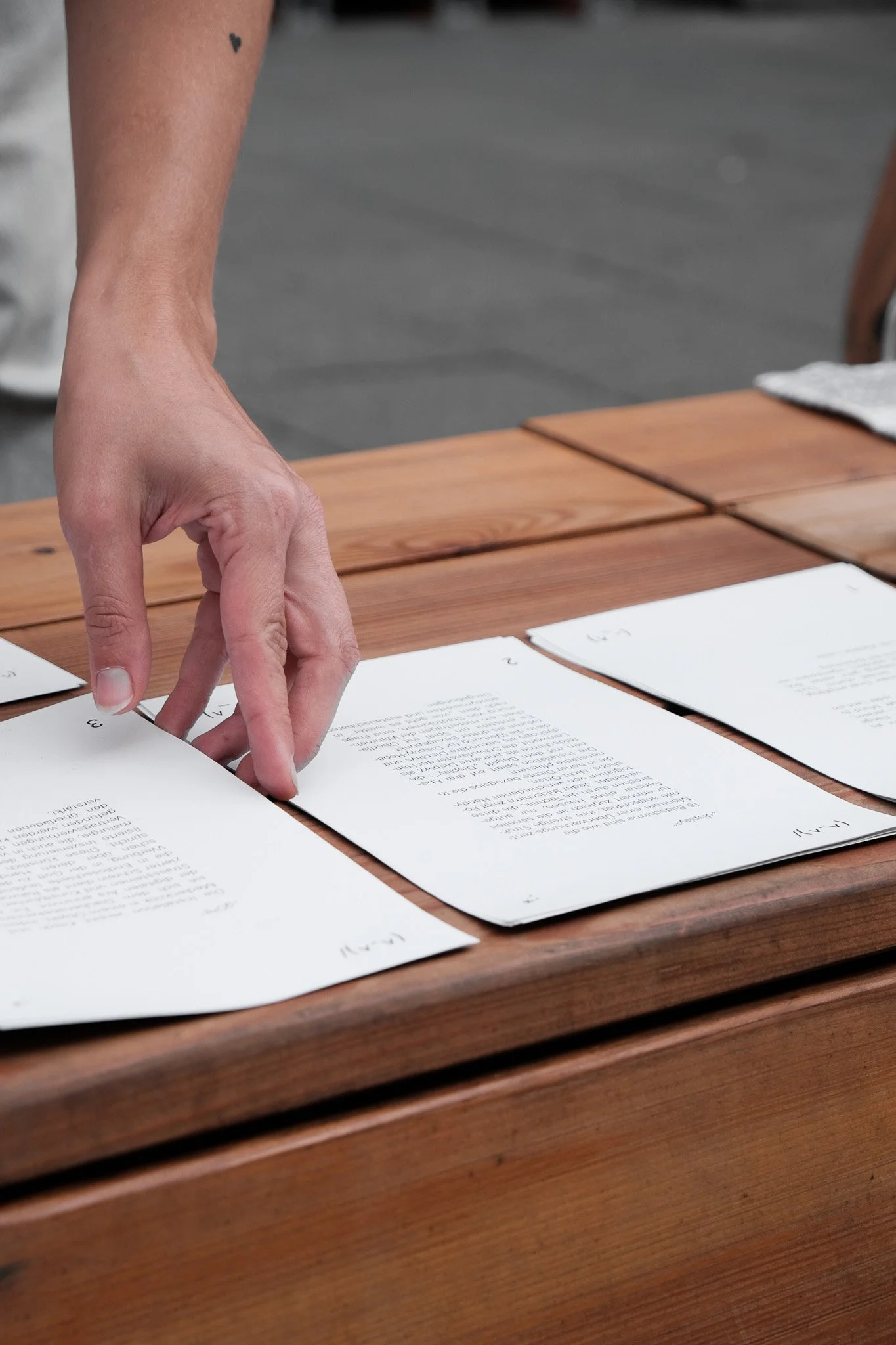mr. watson, come here. i want to see you.
In der Ausstellung wird auf die Gegebenheiten des neuen AStA-Ausstellungsraumes der Kunstakademie Düsseldorf reagiert. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Handyshops setzen sich die Arbeiten mit dessen ortsspezifischen, atmosphärischen Eigenheiten auseinander.
Die Werke thematisieren nicht nur das Kommunizieren, sie treten in einen Dialog mit Emotionen, die an bestimmte Orte gebunden sind – auch Orte, die nicht (mehr) physisch erreichbar sind.
Der Titel der Ausstellung verweist auf die ersten Worte, die 1876 über ein Telefon übermittelt wurden und die damit die direkte Kommunikation über Räume hinweg ermöglichten.
eine Gruppenausstellung von
Dagmar von der Ahe
Suna Ozankan
Benita Thisbe Tauer
Jan Ribbers
Die Installation vereint Kitsch und Medienkritik in einem Objekt, indem sie sich dem Glaubensbekenntnis der digitalen Ära annimmt. Ein mit Strasssteinen und Kunstblumen verzierter Schrein dient als Rahmen für die in Endlosschleife laufende O₂-Werbung, in der Gott zu den Menschen über deren Handykonsum spricht. Diese künstlich emotionalisierte Inszenierung der Werbedramaturgie, die auch in vielen anderen Vertragswerbungen der 10er Jahre gefunden werden kann, wird durch den überladenen Schrein ironisch verstärkt.
gO₂tt
16 Bildschirme sind wie die Monitore einer Überwachungszentrale angeordnet, ihre strenge Struktur erinnert zugleich an die seriellen Fenster eines Hauses, nur aufgebrochen durch die Technik, die sie verbindet. Jeder Bildschirm zeigt Fotografien von verschiedenen Handyshops, Nicht-Orten, die in hoher Dichte bezugslos die Innenstädte pflastern. Die Installation spielt auf drei Ebenen mit dem Begriff “Display”: Die Bildschirme als primäres Display, als Leinwand, die Schaufenster der Handyshops als sekundäre Displays und darin die Werbung für Display-Reparaturen als dritter Bezugspunkt. Es entsteht ein Spiel mit Oberflächen, ein Hinterfragen der Wahrnehmung von Stadträumen, eine Frage nach dem “wie geht es weiter” in anonymisierten und austauschbaren Umgebungen.